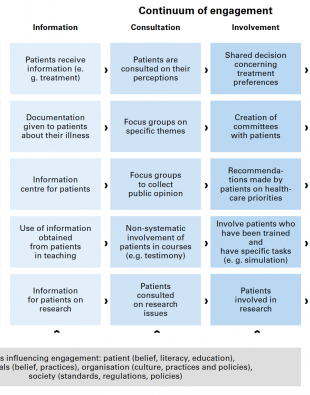«Es braucht eine Bereitschaft zur Öffnung»
Nov. 2019Engaging with patients
Interview. Vorbei ist die Zeit, in der Ärzte alles besser wussten, stellen Martin Stucky und Daniel Scheidegger im gemeinsamen Gespräch fest. Vom vermehrten Einbezug von Betroffenen und Angehörigen profitieren nicht nur die Fachleute, sondern die ganze Gesellschaft.
Herr Stucky, Herr Scheidegger, Patientenpartizipation ist ein Schlagwort, das sympathisch und demokratisch tönt. Doch was bedeutet die Patiententeilhabe für Sie als Arzt und für Sie als Betroffener?
Daniel Scheidegger: Für mich ist Partizipation nicht nur sympathisch – sie ist vor allem auch nötig. Wir Experten können nicht über die Köpfe der Betroffenen hinweg entscheiden, was für sie wichtig und richtig ist. Allerdings haben wir von der Schweizerischen Akademie der Medizinischen Wissenschaften (SAMW) gemerkt, dass es sehr schwierig ist, an Patientinnen und Patienten zu gelangen. Wir haben uns an mehrere Patientenorganisationen gewandt mit der Bitte, uns eine Liste von Personen zuzustellen, die in unseren Arbeitsgruppen die Sicht von Betroffenen einbringen könnten. Wir hatten gehofft, so bei Bedarf auf eine Gruppe von Personen zurückgreifen zu können, je nach Anlass vielleicht auf eine Patientin mit einem Nierenleiden aus der Westschweiz oder einen jungen Diabetes-Betroffenen aus dem Tessin. Aber bisher ist uns das leider nicht gelungen.
Martin Stucky: In meiner Tätigkeit als freischaffender Genesungsbegleiter, aber auch in meiner Teilzeitarbeit im Telefonberatungsdienst der Stiftung Pro Mente Sana in Zürich habe ich hingegen einen engen Kontakt mit Klienten und Patienten. Diese Begegnungen und meine eigene Erfahrung – vor über 20 Jahren habe ich eine Borderline-Persönlichkeitsstörung erlebt – befähigen mich, in öffentlichen Referaten, aber auch in den Selbsthilfegruppen-Tätigkeiten darauf aufmerksam zu machen, dass wir Betroffenen eine Stimme haben und gehört werden wollen.
Im angelsächsischem Raum sei die Patientenpartizipation weiter fortgeschritten, die Schweiz habe deshalb einen Nachholbedarf, stellt die SAMW in ihrer Publikation «Patienten und Angehörige beteiligen» fest. Teilen Sie diese Einschätzung?
Martin Stucky: Ja. Grundsätzlich braucht es eine Bereitschaft zur Öffnung, und zwar auf allen Seiten. Auf der Seite der Betroffenen ist klar, dass wer sich bei Themen der psychischen Erschütterung öffnet, sich dadurch auch angreifbar und verwundbar macht. Da braucht es vor allem am Anfang Mut. Aber auch auf der Seite der Gesellschaft muss man sich fragen: Wie offen ist die Haltung gegenüber Menschen mit psychischen Erschütterungen und Krankheitsbildern? Da sind andere Länder wohl fortschrittlicher und weiter als die Schweiz.
Daniel Scheidegger: Das hat sicher auch mit der Kultur zu tun. In der
Schweiz wird über Krankheiten tendenziell geschwiegen. Das beginnt sich
vielleicht zu ändern, ab und zu hört man von einem Politiker, der sich
öffentlich über seine Erkrankung äussert. Aber wenn Sie in den USA an
der Kasse anstehen, dann wissen Sie nach zehn Minuten, dass die Person
hinter Ihnen im letzten Jahr prostatektomiert wurde. Als Schweizer denke ich manchmal, will ich das überhaupt wissen?
Martin Stucky: Wir werden hier so erzogen, dass wir nicht über Gefühle
sprechen. Bei der Pro Mente Sana haben wir eine Kampagne namens «Wie
geht’s Dir?» gestartet, um das ein bisschen aufzuweichen. Wir denken, es ist gut und wichtig, darüber sprechen zu können, was einen im Inneren
beschäftigt.
In Sachen Partizipation werden hohe Erwartungen an die Patienten- und Selbsthilfeorganisationen herangetragen. Dabei bleibt aber deren Rolle oft unklar. So scheinen Schwierigkeiten in der Paarbeziehung vorprogrammiert.
Daniel Scheidegger: Erstens ist es uns noch nicht gelungen, eine Paarbeziehung zu etablieren. Und zweitens sind unsere Erwartungen so hoch auch wieder nicht. Wenn wir Probleme lösen wollen, von denen andere betroffen sind, hätten wir einfach gerne jemanden am Tisch, der uns rückmeldet, wenn wir auf dem Holzweg sind. Ein Beispiel: Ich war lange im Vorstand der Schweizer Paraplegikerstiftung. Da ist auch jeweils ein Betroffener mit dabei. Als wir die Forschungsprojekte besprachen, ging es um Exoskelette und wie vorzugehen ist, damit die Betroffenen wieder zu Fuss unterwegs sein können. Da meldete sich der Paraplegiker zu Wort: Die Mobilität war nicht sein Problem. Mit dem Rollstuhl hatte er sich abgefunden. Was ihm zu schaffen machte, war seine Harnblase, das Anlegen des Katheters und die Infekte. Daran haben wir anderen überhaupt nicht gedacht.
Martin Stucky: Im Rat der Betroffenen des BAG sehe ich meine Rolle als sogenannter «Fachexperte in Erfahrung» so, dass ich als Sprachrohr die Wahrnehmung und die Bedürfnisse von Betroffenen nach aussen trage. Es geht dabei immer auch um Aufklärungs- und Anti-
stigmatisierungsarbeit. Sehr oft stelle ich dabei fest, dass das Publikum – und die Gesellschaft als Ganzes – unsere Leiden anders wahrnimmt als wir selbst. Aus diesem Grund finde ich es wichtig, dass sich Betroffene organisieren und eine Plattform bilden. Wir ermuntern die Leute, sich als Betroffene zu outen. Ich bin überzeugt, dass das in Zukunft mehr passieren wird.
Gehört das für Sie zu Ihrer Arbeit als Genesungsbegleiter, den Leuten Mut zu machen?
Martin Stucky: Auf jeden Fall. Ich begegne immer wieder Personen, die es nicht wagen, ihrem Arbeitgeber anzuvertrauen, dass sie in einer seelischen Krise stecken. Ich frage meine Klienten immer: «Was braucht es, damit du deinem Chef sagen kannst: ‹Das und das beschäftigt mich, ich benötige im Moment etwas mehr Raum und Entlastung›?» Das Wichtigste ist, dass so eine Aussage keine negativen Konsequenzen hat. Wenn sich schon jemand traut, seine Probleme anzusprechen, darf das nicht dazu führen, dass er dadurch seine Arbeitsstelle gefährdet. Viel zu oft aber passiert genau das, gerade bei Menschen mit psychischen Erschütterungen. Wenn sich die Arbeitgeber überfordert fühlen, fragen sie sich, ob die Person noch belastbar ist und die Aufgaben erledigen kann, anstatt auf die Bedürfnisse einzugehen und nach einer für alle verträglichen Lösung zu suchen. Deshalb ist es wichtig, auch die Arbeitgeber zu beraten, damit sie ihrer Aufgabe nachkommen können, für eine gute Arbeitsumgebung zu sorgen.
Zurück zum Dialog zwischen Arzt und Betroffenen. Das sind in vielen Fällen ja nicht nur die Patienten, sondern auch die Angehörigen. Auch sie müssen unter Umständen ihr Leben neu ausrichten.
Daniel Scheidegger: Ja, wenn sich Angehörige an der Pflege beteiligen, müssen sie natürlich eingebunden werden, idealerweise von Anfang an. Das setzt allerdings voraus, dass der Patient selbst damit einverstanden ist, seine Angehörigen mit ins Boot zu holen.
Martin Stucky: In meiner Arbeit habe ich sehr viel mit Angehörigen zu tun, vor allem zu Beginn, wenn sich Betroffene aus Scham oder aus Angst weigern, mit einem Genesungsbegleiter in Kontakt zu treten. Die Angehörigen sind ein wesentlicher Faktor im System. Auch sie können mit einem günstigen oder weniger günstigen Verhalten beeinflussen, wie sie am Betroffenen empathisch und wohlwollend dranbleiben können, ohne dass ihnen die Situation zu nahe geht. Aber wie beim Betroffenen selbst braucht es auch bei den Angehörigen eine Bereitschaft, hinzuschauen und einen Teil zur Lösung beisteuern zu wollen. Das Thema Enttabuisierung und Entstigmatisierung macht vor niemandem Halt.
Seit einiger Zeit macht das Schlagwort Patientenermächtigung oder «Patient Empowerment» die Runde. Aber inwiefern bedeutet der Machtgewinn der Patientin auch einen Kontrollverlust des Arztes?
Daniel Scheidegger: Für mich ist es selbstverständlich, dass wir Ärzte nicht alles besser wissen. Wenn ein Patient mit einem Problem kommt, kann ich ihn nicht nach drei Sätzen unterbrechen, um Tabletten zu verschreiben. Ich muss zuerst zuhören und versuchen zu verstehen, worum es geht. Aber die Patientenermächtigung hat auch Grenzen. Viele Patienten finden im Internet Angebote mit falschen Versprechen, etwa zu Stammzelltherapien. Da verkauft man ihnen für viel Geld Behandlungen im Ausland, die unter Umständen mehr schaden als nützen. Als Arzt möchte ich das gemeinsame Gespräch schon auf Augenhöhe führen, trotzdem kann ich als Spezialist viele Gesundheitsinformationen besser einordnen, weil ich mich auf eine solide Wissensbasis stützen kann, die ich mir im sechsjährigen Medizinstudium erworben habe.
Martin Stucky: «Patient Empowerment» heisst für mich in meiner Arbeit, Hoffnung und Zuversicht zu vermitteln. Ich kann als Peer mein Wissen und meine Erfahrungen einbringen, aber keinesfalls in der Haltung von «ich weiss genau, was du jetzt brauchst». Ich glaube, eine tolle Haltung eines jeden Helfenden – ob Angehörige oder auch Ärzte – ist, zu merken, wann und wie weit man die Situation in die Eigenverantwortung des Betroffenen übergeben kann.
Wo sehen Sie eine Entwicklung im Patienteneinbezug?
Martin Stucky: An vielen Orten. Bei Pro Mente Sana zum Beispiel haben wir in den letzten Jahren einen so genannten «Peer Pool» aufgebaut. Das sind fast 100 Personen, die unterschiedliche Erkrankungen erlebt haben und nun bereit sind, mit ihren Erfahrungen heutigen Betroffenen beizustehen. Aber auch gesellschaftlich findet die Idee immer mehr Anklang. Wenn wir als Gesellschaft den Nutzen und den Gewinn der Genesungsbegleitung erkennen, profitieren auch alle davon. Ganz besonders freut mich in dieser Hinsicht, dass die IV-Stelle in Graubünden erstmals einen Peer angestellt hat. Wenn Sie einen Menschen mit psychischen Erschütterungsbildern wieder integrieren möchten, kann es hilfreich sein, wenn er mit einer Person zusammenarbeiten kann, die vielleicht schon Ähnliches erfahren hat und weiss, wovon er redet.
Denken Sie, dass die Patientenpartizipation finanziell gefördert werden sollte?
Martin Stucky: Ganz klar ja. So lange die Genesungsbegleitung nicht als krankenkassenpflichtige Leistung gilt, bleibt das Finanzielle bei vielen Betroffenen ein grosses Thema.
Daniel Scheidegger: Wenn wir Leute für unsere Arbeitsgruppe suchen, bieten wir ihnen ja keine Hilfe an, sondern wollen, dass sie uns helfen. Deshalb bezahlen wir den Personen, die an unseren Sitzungen teilnehmen, Tagesgelder, um sie für ihren Aufwand zu entschädigen.
Zum Abschluss: Herr Stucky, was wünschen Sie sich als Betroffener von den Gesundheitsexperten?
Martin Stucky: Das Wichtigste ist Offenheit und die Bereitschaft, genau hinzuhören. Wenn das Ich-Wissen des Betroffenen mit dem Du-Wissen des Experten zusammenkommt und ein gemeinsames Wir-Wissen entsteht, dann hilft das dem Betroffenen am besten.
Daniel Scheidegger: Einverstanden: Wenn ein Patient kommt, muss ich herausfinden, was ihn stört. Wenn er Atemnot hat, dann sollte ich mich nicht auf einzelne Blutwerte konzentrieren, die vielleicht etwas ausserhalb der Norm liegen, sondern den Patienten und sein Problem ernst nehmen. Die Ursache kann ja vielfältig sein. Gemeinsam kommt man sicher schneller zum Ziel.
Und Sie, Herr Scheidegger, was wünschen Sie sich als Mediziner von den Betroffenen?
Daniel Scheidegger: Ich wünsche mir, dass Betroffene verstärkt realisieren, dass ihre Sichtweisen gefragt sind und wir sie gerne bei unseren Gesprächen dabeihätten.